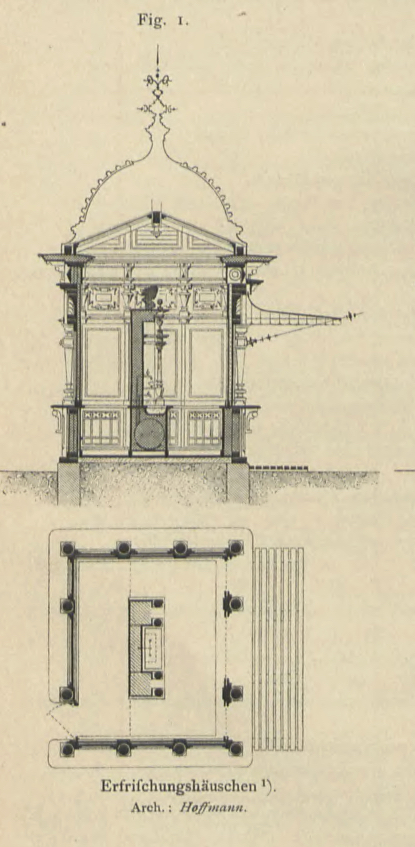April 1949. Das „Feudalmuseum Schloss Wernigerode“ in Sachsen-Anhalt wird eröffnet. Die Benennung greift einen wichtigen Begriff der marxistischen Theorie auf, in der der Feudalismus als der von Leibeigenschaft und Fürstenherrschaft geprägte Vorläufer der kapitalistischen Epoche gilt, letztlich also als eine der Epochen, die der Erringung des Kommunismus notwendigerweise vorangingen. Das „Neue Deutschland“ feierte in jenem Jahr unter dem Titel „Wegelager, Spekulanten und Kavaliere“ den Wertewandel im neuen sozialistischen Staat, den das Museum verkörpere: „Es war einmal. So möchte ich diese Schilderung beginnen, obwohl es sich durchaus nicht um ein Märchen handelt. Die Prinzen, Grafen und Komtessen haben sich aus dem Staub gemacht, und alle die vielen verschrobenen Figuren in blinkender Montur, die zum operettenhaften Hofstaat eines Duodezfürsten oder altadligen Großgrundbesitzers gehörten, sind ihnen gefolgt. Es war einmal, sage ich und blicke aus dem großen Fenster eines feudalen Salons in den schattigen Hof des Wernigeroder Schlosses, das vor kurzem zum ‚Feudal-Museum‘ geworden ist. Der Prismenschliff der Kronleuchter glitzert im großen Festsaal. Das erlesene Porzellan der Tafelaufsätze glänzt. Herrliche Fayencen aus Delft prahlen auf hohen Schaubufetten, japanische Vasen stechen mit ihren exotischen Reizen alte Majoliken aus Zerbst und Meißen aus. Von den mit Seidentapeten bespannten Wänden drohen oder lächeln, je nach Temperament, die Raubritter- und Kavaliergesichter der Ahnen. Verstaubte Historie vermischt sich in diesem Museum mit jüngster Vergangenheit. Die Fülle der Kunstwerke ist so groß und faszinierend, daß mancher die inneren Zusammenhänge vergäße, wenn er nicht durch einige geschickt angebrachte Schilder darauf hingewiesen wurde, daß er es hier mit dem ‚Nachlaß‘ des Feudaladels der Schlösser Wernigerode, Ilsenburg und Blankenburg zu tun hat. Durch jahrhundertelange Ausbeutung ihrer Untertanen konnten die hohen Herren der ’schwarzen Reichsgrafschaft‘ Wernigerode solche Schätze aufhäufen. Ihre Methoden wechselten von der Wegelagerei bis zur Börsenspekulation. In ihren ‚besten Jahren‘, Ende des vergangenen Jahrhunderts, besaßen die Fürsten von Wernigerode drei große Schlösser, zwölf Domänen, 27 000 ha Grundbesitz, neun Warenhäuser und Industrieunternehmungen und dicke Aktienpakete von vier großen Industriewerken. Dann bekam Fürst Otto, der sich gern in operettenhafter Pose photographieren ließ, den Baufimmel und steckte 2,5 Millionen Mark in den Umbau seines Stammsitzes. Er ließ das alte Gemäuer, der verlogenen Manier der achtziger Jahre folgend, auf Gotisch frisieren. Der glänzende Lebensstil, die Hoffeste, die großen Jagden, die Reisen nach Monaco und an die Riviera verschlangen riesige Summen, so daß die wahrhaft fürstlichen Einnahmen von jährlich rund 5 Millionen Mark nicht ausreichten. Die Folgen waren Schulden über Schulden. Der Grundbesitz bröckelte immer mehr ab, ganze Waldreviere im Harz wurden verschachert und wanderten über das Roulette in die Taschen von Lebemännern und Abenteurern. 1927 war die Schuldenlast auf 10 Millionen Mark gestiegen. Da kam dem verkrachten Fürsten Ernst Christian, dessen frühere intime Beziehungen zu Wilhelm II. und Philipp von Eulenburg auch in der Weimarer Republik noch Gewicht hatten, eine schwarzweißrote Querverbindung zum preußischen Finanzministerium zugute. Der Staat kaufte dem Fürsten das Wernigeroder Schloß mit seinen siebzig Prunkgemächern ab, und der Erlös befriedigte einen Teil der Gläubiger. Das immerhin noch stattliche Erbe rettete Bodo von Stolberg-Wernigerode, Ernst Christians Sohn, der bis 1945 unterhalb des Schlosses in einer großen. Villa sein fürstliches Leben führte, über den Krieg hinweg. Dann zog er es vor, im Geleitschutz der Engländer über den Harz nach Westen auf sein Schloß Gedern bei Frankfurt am Main zu retirieren. Wenig später folgte ihm der Herzog von Blankenburg mit langem Troß. Die britische Armee hatte ihm zwanzig Lastwagen für den Umzug zur Verfügung gestellt. Bald darauf verfiel der Land- und Forstbesitz der Bodenreform. Wenn heute die Neubauern nach des Tages Arbeit heimwärts gehen, blicken sie auf das hochgelegene Schloß mit den spitzen Giebeln, Türmen und Zinnen. Wenn da ein Stein vom Dache fiele – es bückte sich niemand, der ihn aufnähme. Die Vergangenheit ist tot. Es war einmal … K.B.“ (Neues Deutschland, 12. Mai 1949).
In geringem Umfang machte die Benennung sogar Schule – vermutlich auch, weil sie den Weiterbetrieb von Schlossmuseen mit Exponaten aus der höfischen und ritterschaftlichen Kultur in der DDR legitimieren sollte. 1950 berichtete die DDR-Zeitung „Neue Zeit“, dass nun auch auf der thüringischen Heldburg ein „Feudalmuseum“ eingerichtet werden solle (NZ, 31. Oktober 1950).
In Wernigerode wurde 1951 erweitert: „Museumsleiter Kusche hat in fünf Räumen die Entwicklung des Feudalismus bis zum Frühkapitalismus in mustergültiger Weise herausgearbeitet. Neben den bisherigen Räumen sind neue kunsthistorische Räume eingerichtet worden, so daß die Gesamtbesichtigung des Feudalmuseums bis zur letzten Phase interessant und fesselnd ist. Zum ersten Male wird auch eine Folterkammer aus dem Mittelalter in den Kellergewölben des Museums gezeigt, die Richtbock, Richtschwerter, Folter- und Strecktisch aufweisen“ (NZ, 6. April 1951).
Am Ausgang wurden die Besucher mit einer Inschrift verabschiedet: „Sie haben gesehen, wieviel Schönes die arbeitenden Menschen in der Vergangenheit geschaffen haben für das Wohlleben ihrer Herren. Um wieviel mehr wird unser Volk heute und in Zukunft schaffen, wo es für sich selbst arbeitet, Schlösser und Paläste dem Volk gehören“ (zit. nach Neues Deutschland, 20. Mai 1956).
In der Berichterstattung der DDR-Presse ließ der ideologische Schwung in der Berichterstattung über das Museum in den folgenden Jahrzehnten deutlich nach, wohl parallel zum schwindenden Enthusiasmus über das Ende der „Junkerherrschaft“ – nicht weil alles falsch gewesen war, was man über die ehemaligen Herren geschrieben hatte, sondern weil die DDR sich nicht als der glanzvolle Nachfolger entpuppte, den man sich erträumt hatte. Das bis 1989 unter dieser Bezeichnung fortbestehende Feudalmuseum wurde in der Presse der 1960er- bis 1980er-Jahre ohne jeglichen Hinweis auf die ihm einst zugedachte ideologische Rolle als ein „normales“, vielbesuchtes Schlossmuseum gehandelt. So heißt es 1977: „Ein beliebtes Ziel für Harzurlauber ist das ‚Feudalmuseum‘ im Schloß Wernigerode. Der 1883 vollendete Repräsentationsbau beherbergt meisterhaft gearbeitete Möbel, hier sind Hunderte von Gemälden, charakteristische Kleidungsstücke, kostbare Schmuck- und Gebrauchsgegenstände, darunter einzigartige Porzellane, zu bewundern. Der größte Teil dieser Kulturgüter stammt aus früheren Adelssitzen Sachsen-Anhalts“ (Neues Deutschland, 23. Juli 1977). Zwei Jahre später trugen Kunsthistoriker, Architekten und Kulturwissenschaftler eben hier bei einer Historismus-Tagung das lang gepflegte Feindbild der Architektur des 19. Jahrhunderts zu Grabe, also eben jenes Feindbild, welches das Wernigeröder Schloss paradigmatisch verkörperte: „Die neogotischen und neobarocken Bau- und Kunstwerke, die Zeugen der Renaissance-Wiederbelebung sind Denkmale, denn sie spiegeln geistige und materielle Verhältnisse ihrer Zeit wider, sie sind Belegstücke der großen ideologischen und nicht zuletzt klassenkämpferischen Auseinandersetzungen, dokumentieren imperialen Machtanspruch aber eben auch hochentwickelte künstlerische und ebenso gestalterische Maßstäbe“ (Neue Zeit, 13. November 1979). 1984 veröffentlichte Direktor Konrad Breitenborn eine Biographie des Fürsten Otto zu Stolberg-Wernigerode (1837–1896), unter dem das Schloss seine neugotisch-repräsentative Gestalt erhalten hatte. Die eher nüchterne Besprechung im Neuen Deutschland deutet zwar den Niedergang des Adels im Sinne der marxistischen Ideologie als historische Endgültigkeit an, ist aber erkennbar nicht mehr zum Furor früherer Zeiten bereit: „Der letzte Sproß des alten Feudalgeschlechts, der noch einmal Bedeutung erlangte und es, wenn auch nur kurze Zeit, zum Vizekanzler des neudeutschen Kaiserreiches brachte, war, wie Breitenborn dartut, keine überragende Persönlichkeit. Die individuelle Ambition überstieg fraglos die staatsmännischen Fähigkeiten. […] Breitenborn hat gut daran getan, die hausgemachten Lorbeerkränze der Familie Stolberg-Wernigerode gründlich zu entblättern. Darin liegt ein entschiedener Gewinn für den Leser“ (Neues Deutschland, 10. November 1984).
Nach der politischen Wende von 1989 und der Wiedervereinigung behielt das Museum zunächst erstaunlich lange seinen Namen. Wie wenig der Begriff des „Feudalmuseums“ offenbar „verbrannt“ war, zeigt auch die Tatsache, dass die Wiederöffnung des Schlosses Rheinsberg in Brandenburg im Mai 1991 nach Jahrzehnten der medizinischen Nutzung in der DDR ebenfalls als „Feudalmuseum“ bezeichnet wurde (Berliner Zeitung, 28. August 1992). Allerdings behauptet ein Artikel der „Berliner Zeitung“ vom 28. Oktober 1993, das Wernigeröder Feudalmuseum sei bereits früher umbenannt worden und fasst die programmatischen Veränderungen wie folgt zusammen: „Nach der Wende im Jahr 1989 begann man, dem nunmehrigen ‚Schloßmuseum Wernigerode‘ im Besitz des Landkreises seinen ursprünglichen Wohncharakter des 19. Jahrhunderts zurückzugeben. Rekonstruiert wurden u. a. das Arbeitszimmer des Fürsten, der Salon seiner Gattin sowie das Schlafgemach.“
© Katrin und Hans Georg Hiller von Gaertringen
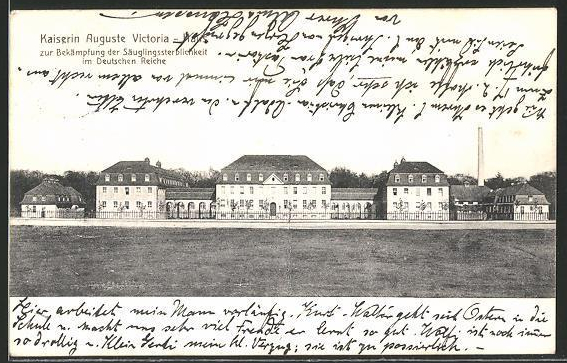
 Der Industrielle Alfred Pierburg war einer der erfolgreichsten Autozulieferer der Nachkriegszeit. Sein in Neuß und West-Berlin ansässiges Unternehmen, die „Deutsche Vergaser-Gesellschaft“, stattete in der Zeit des Wirtschaftswunders nahezu jedes in Deutschland gebaute Kraftfahrzeug mit einem Vergaser aus (Marke „Solex“). 1958 gründete Pierburg, auch als Zeichen des wirtschaftlichen Erfolgs, das „Deutsche Vergasermuseum“, welches in einem Pavillon auf dem Werksgelände untergebracht wurde. Die mehr als problematischen Konnotationen der Begriffsverbindung von „deutsch“ und „vergasen“ scheinen damals nicht nur den Gründer nicht gestört zu haben – in keinem der zeitgenössischen Berichte wurde an dem Namen Anstoß genommen. Die technikgeschichtliche Ausstellung auf dem Firmengelände richtete sich wohl vor allem an Kunden des Unternehmens: Es ist nicht anzunehmen, dass sich Besucher zufällig in die abgelegene Heidestraße nach Moabit verirrten. Mit 500 Vergaseraggregaten und -teilen, die in einem dezidiert modern gestalteten Schauraum in Glasvitrinen aufgestellt waren, wurde die Geschichte der Vergasertechnik seit den 1860er Jahren dokumentiert. Nachdem Pierburg 1975 starb, wurde das Museum 1982 aufgelöst und die Sammlung dem Berliner Technikmuseum übergeben. Im letzten Jahr seines Bestehens hatte es laut Statistischem Jahrbuch 1.005 Besucher gehabt. 1986 verkaufte Pierburgs Sohn auch die Firma selbst an Rheinmetall.
Der Industrielle Alfred Pierburg war einer der erfolgreichsten Autozulieferer der Nachkriegszeit. Sein in Neuß und West-Berlin ansässiges Unternehmen, die „Deutsche Vergaser-Gesellschaft“, stattete in der Zeit des Wirtschaftswunders nahezu jedes in Deutschland gebaute Kraftfahrzeug mit einem Vergaser aus (Marke „Solex“). 1958 gründete Pierburg, auch als Zeichen des wirtschaftlichen Erfolgs, das „Deutsche Vergasermuseum“, welches in einem Pavillon auf dem Werksgelände untergebracht wurde. Die mehr als problematischen Konnotationen der Begriffsverbindung von „deutsch“ und „vergasen“ scheinen damals nicht nur den Gründer nicht gestört zu haben – in keinem der zeitgenössischen Berichte wurde an dem Namen Anstoß genommen. Die technikgeschichtliche Ausstellung auf dem Firmengelände richtete sich wohl vor allem an Kunden des Unternehmens: Es ist nicht anzunehmen, dass sich Besucher zufällig in die abgelegene Heidestraße nach Moabit verirrten. Mit 500 Vergaseraggregaten und -teilen, die in einem dezidiert modern gestalteten Schauraum in Glasvitrinen aufgestellt waren, wurde die Geschichte der Vergasertechnik seit den 1860er Jahren dokumentiert. Nachdem Pierburg 1975 starb, wurde das Museum 1982 aufgelöst und die Sammlung dem Berliner Technikmuseum übergeben. Im letzten Jahr seines Bestehens hatte es laut Statistischem Jahrbuch 1.005 Besucher gehabt. 1986 verkaufte Pierburgs Sohn auch die Firma selbst an Rheinmetall.