
Wechselnde Standorte in Berlin-Mitte. Öffnungszeiten 1936: Täglich 10–22 / 1933 Eröffnung in der Jüdenstr. 33 / 1934 Umzug in die Neue Friedrichstr. 83 / um 1936 ansässig in der Taubenstr. 7 / Mai 1938 Umzug an die Neue Promenade 2 / um 1943 kriegsbedingte Schließung
Im März 1933 verwüstete die Berliner „SA-Standarte 6“ das pazifistische Anti-Kriegs-Museum. Kurze Zeit später gründete sie selbst ein kleines, agitatorisch geprägtes Museum. Es war eine der wenigen Museumsgründungen der NS-Zeit, in der man statt auf neue Museen eher auf temporäre Propagandausstellungen wie die „Entartete Kunst“ setzte. Mit dem Namen wurde auf die nach der Oktoberrevolution gegründeten „Revolutionsmuseen“ in der Sowjetunion angespielt, denen die SA-Männer ein eigenes Museum der „nationalen Revolution“ entgegenstellten. Jedoch war der Titel doppeldeutig: Hier wurde zugleich die von der NS-Bewegung vermeintlich vereitelte kommunistische Revolution musealisiert.
Spätestens im Juli 1934, als Hitler die SA beim „Röhm-Putsch“ gewaltsam entmachtete, war die Idee einer nationalen Revolution jedoch hinfällig. Nun entwickelte sich das Museum zum bloßen Traditionskabinett der Berliner SA, wo man sich, nicht ohne Wehmut, an die bürgerkriegsähnlichen Kämpfe der frühen dreißiger Jahre erinnerte. Sowohl die gewaltsame Aneignung der kommunistischen Ausstellungsstücke als auch der diffamierende Duktus der Inschriften verliehen der Ausstellung den Charakter eines Anti-Museums, das nicht nur den politischen Gegner, sondern auch die bürgerlichen Bildungsideale verhöhnte.
Ausgestellt waren einerseits eigene Memorabilien, andererseits Beutestücke aus dem Kampf mit dem politischen Gegner: Fotos, Dokumente, Uniformen, Abzeichen, Banner, Orden und Waffen. Eine prominente Siegestrophäe war der rote Stern von Mies van der Rohes 1926 errichtetem Revolutionsdenkmal auf dem Sozialistenfriedhof Friedrichsfelde. Aus dem „Institut für Sexualwissenschaft“ von Magnus Hirschfeld präsentierte man dessen im Mai 1933 erbeutete Büste. Auch die Freimaurer und – gemäß dem sozialrevolutionären Gedankengut der SA – die Monarchie wurden nicht ausgespart. Ein in diesem Sinne gezeigtes Foto Kaiser Wilhelms I. mit Freimaurerschürze missfiel allerdings dem konservativen Reichswehrministerium, so dass es wieder entfernt werden musste. Als besondere Machtdemonstration wurde dem Besucher die Aneignung privater Gegenstände vorgeführt, etwa die Ohrringe der vormaligen kommunistischen Reichstagspräsidentin Clara Zetkin oder die Brille des jüdischen Berliner Polizeipräsidenten der Weimarer Zeit, Bernhard Weiß. Sowohl mehrere Ortswechsel als auch die geringen Besucherzahlen (1937: 18.000 Besucher) lassen nicht auf eine sonderlich starke Unterstützung durch die NS-Machthaber schließen. Das Schicksal der Bestände in Krieg und Nachkriegszeit ist unbekannt.
Aus unserem Buch „Eine Geschichte der Berliner Museen in 227 Häusern“, Berlin/München: Deutscher Kunstverlag, 2014
Ausführlicher in unserem Aufsatz: NS-Revolutionsmuseum statt Anti-Kriegs-Museum? Zur Entwicklung der Berliner Museumslandschaft in der NS-Zeit, in: Tanja Baensch, Kristina Kratz-Kessemeier, Dorothee Wimmer (Hg.): Museen im Nationalsozialismus. Akteure – Orte – Politik, Köln: Böhlau Verlag, S. 99–112
© Katrin und Hans Georg Hiller von Gaertringen
Nachtrag vom 28. Januar 2018
In der 2013 freigeschalteten Datenbank „Pressechronik 1933“ haben wir erst jetzt einen uns bislang unbekannten Artikel von damals zum NS-Revolutionsmuseum entdeckt. Hier in voller Länge wiedergegeben:
Das Revolutions-Museum der SA-Standarte 6
Im Zentrum der Stadt, unweit der Parochialkirche mit dem berühmten Glockenspiel, in der Jüdenstraße, gegenüber dem Stadthaus, hat die SA-Standarte 6 der Gruppe Berlin-Brandenburg sich eine Stätte geschaffen, in der Reliquien, die sich im Laufe der Zeit bei der Standarte angesammelt haben, ausgestellt sind. Schon von weitem leuchtet ein weißes Transpart mit der Aufschrift „Nationalsozialistisches Revolutionsmuseum“. Es ist ein langer, schmaler Laden einer ehemaligen Schokoladenhandlung. Hier hat man unter der rührigen Leitung des Standartenführers Markus das Erinnerungsmaterial zusammengetragen. Gleich am Eingang befindet sich das blumengeschmückte Bild des obersten SA-Führers Adolf Hitler; ihm gegenüber sind die heiligsten Reliquien der Standarte aufgestellt, Dokumente des Sturmführers Horst Wessel und die erste Sturmfahne Berlins, die sich im Besitz des Oberführers Richard Fiedler befindet und die er der Ausstellung zur Verfügung gestellt hat. Weiter sieht man Waffen aller Art wie großkalibrige Revolver, Pistolen, Maschinenpistolen, Säbel, Schlag- und Hiebwaffen aller Art, Sprengbomben, die früher der Kommunismus im Kampf gegen die Nationalsozialisten gebraucht hat. Dann Trophäen von SA-Männern, die sie dem Reichsbanner abgenommen haben, Armbinden und Abzeichen verschiedenster Art. Auf einem besonderen Tisch liegen die verschiedensten Flugblätter und Hetzzeitschriften der ehemaligen marxistischen Parteien. Als besonders wertvolles Stück sieht man die erste kommunistische Fahne Berlins, eine reinseidene Fahne mit goldener Handmalerei, die sich noch bis vor kurzem im Besitz des ehemaligen kommunistischen Schriftstellers Ernst Friedrich befand. Von dem ehemaligen Vize-Polizeipräsidenten Weiß ist u. a. die Brille ausgestellt, die er anscheinend bei seiner Flucht auf seinem Schreibtisch hat liegen lassen. Die Ausstellung wird durch Beiträge aus allen Gauen Deutschlands ständig erweitert.
Aus der Berliner Morgenpost vom 27. Juli 1933
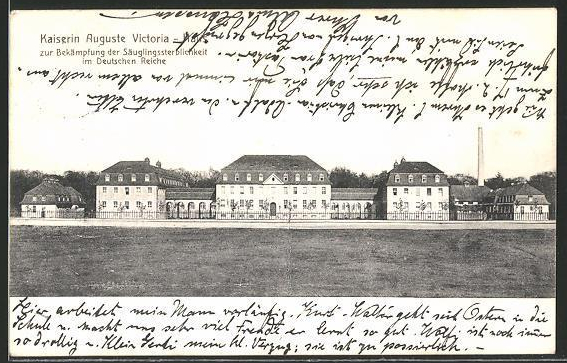
 Der Industrielle Alfred Pierburg war einer der erfolgreichsten Autozulieferer der Nachkriegszeit. Sein in Neuß und West-Berlin ansässiges Unternehmen, die „Deutsche Vergaser-Gesellschaft“, stattete in der Zeit des Wirtschaftswunders nahezu jedes in Deutschland gebaute Kraftfahrzeug mit einem Vergaser aus (Marke „Solex“). 1958 gründete Pierburg, auch als Zeichen des wirtschaftlichen Erfolgs, das „Deutsche Vergasermuseum“, welches in einem Pavillon auf dem Werksgelände untergebracht wurde. Die mehr als problematischen Konnotationen der Begriffsverbindung von „deutsch“ und „vergasen“ scheinen damals nicht nur den Gründer nicht gestört zu haben – in keinem der zeitgenössischen Berichte wurde an dem Namen Anstoß genommen. Die technikgeschichtliche Ausstellung auf dem Firmengelände richtete sich wohl vor allem an Kunden des Unternehmens: Es ist nicht anzunehmen, dass sich Besucher zufällig in die abgelegene Heidestraße nach Moabit verirrten. Mit 500 Vergaseraggregaten und -teilen, die in einem dezidiert modern gestalteten Schauraum in Glasvitrinen aufgestellt waren, wurde die Geschichte der Vergasertechnik seit den 1860er Jahren dokumentiert. Nachdem Pierburg 1975 starb, wurde das Museum 1982 aufgelöst und die Sammlung dem Berliner Technikmuseum übergeben. Im letzten Jahr seines Bestehens hatte es laut Statistischem Jahrbuch 1.005 Besucher gehabt. 1986 verkaufte Pierburgs Sohn auch die Firma selbst an Rheinmetall.
Der Industrielle Alfred Pierburg war einer der erfolgreichsten Autozulieferer der Nachkriegszeit. Sein in Neuß und West-Berlin ansässiges Unternehmen, die „Deutsche Vergaser-Gesellschaft“, stattete in der Zeit des Wirtschaftswunders nahezu jedes in Deutschland gebaute Kraftfahrzeug mit einem Vergaser aus (Marke „Solex“). 1958 gründete Pierburg, auch als Zeichen des wirtschaftlichen Erfolgs, das „Deutsche Vergasermuseum“, welches in einem Pavillon auf dem Werksgelände untergebracht wurde. Die mehr als problematischen Konnotationen der Begriffsverbindung von „deutsch“ und „vergasen“ scheinen damals nicht nur den Gründer nicht gestört zu haben – in keinem der zeitgenössischen Berichte wurde an dem Namen Anstoß genommen. Die technikgeschichtliche Ausstellung auf dem Firmengelände richtete sich wohl vor allem an Kunden des Unternehmens: Es ist nicht anzunehmen, dass sich Besucher zufällig in die abgelegene Heidestraße nach Moabit verirrten. Mit 500 Vergaseraggregaten und -teilen, die in einem dezidiert modern gestalteten Schauraum in Glasvitrinen aufgestellt waren, wurde die Geschichte der Vergasertechnik seit den 1860er Jahren dokumentiert. Nachdem Pierburg 1975 starb, wurde das Museum 1982 aufgelöst und die Sammlung dem Berliner Technikmuseum übergeben. Im letzten Jahr seines Bestehens hatte es laut Statistischem Jahrbuch 1.005 Besucher gehabt. 1986 verkaufte Pierburgs Sohn auch die Firma selbst an Rheinmetall.








